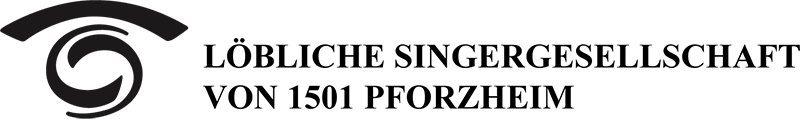Eröffnungsrede Oberbürgermeister Gert Hagerzur „Woche der Brüderlichkeit“ 2010
am 07.03.10
Die diesjährige „Woche der Brüderlichkeit“ steht unter dem Motto „verlorene Maßstäbe“.
Bereits 1980 galten bei der ersten „Woche der Brüderlichkeit“ in Pforzheim hohe Maßstäbe.
Ich bin stolz, sagen zu können, dass diese hohen Ansprüche auch dreißig Jahre später immer noch
erfüllt werden. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bei allen Beteiligten bedanken –
durch ihr Engagement ist auch dieses Jahr wieder ein hochkarätiges und abwechslungsreiches Programm entstanden.
Herzlichen Dank!Obwohl die „Woche der Brüderlichkeit“ in den Anfangsjahren bei der Bevölkerung große Resonanz
fand, kamen Mitte der 80er Jahre auch kritische Stimmen auf. Als eines der Gegenargumente wurde
ein möglicher Rückgang des Interesses in der Bevölkerung vorgebracht. Jedoch hielten die Initiatoren weiterhin an dieser wichtigen interkulturellen Veranstaltung fest. Nicht zuletzt einem stets abwechslungsreichen und kontinuierlich erweiterten Programm ist es zu verdanken, dass eine „Übersättigung“ des Publikums ausblieb. Das ungebrochene Interesse zeugt aber auch von den guten Beziehungen der Pforzheimer Religionsgemeinschaften zueinander. So ermöglichte die jüdische
Gemeinde mit eigenen Veranstaltungen zunehmend Einblicke in das religiöse Leben der Gemeinde.
Durch die Einbindung der Muslimischen Gemeinde 2008 sind nun alle großen Religionsgemeinschaften unserer Stadt an der „Woche der Brüderlichkeit“ beteiligt.
Verlorene Maßstäbe?
Ein Motto, das unter anderem angesichts der Bankenkrise und ihrer Auswirkungen an Aktualität kaum
zu überbieten ist. Die Kritik an der Erhebung des „schnöden Mammons“ zum Maß aller Dinge und die Forderung nach sozial verantwortlichem Handeln prägen den öffentlichen Diskurs.
Bereits der Philosoph Immanuel Kant forderte im 18. Jahrhundert: „Handle stets so, dass die Maxime Deines Willens zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte.“
Oder anders gesagt: „Was du nicht willst, dass man dir tu – das füg auch keinem anderen zu.“
So umschreibt der Volksmund Kants kategorischen Imperativ.
Trotz der Einfachheit dieser Regel kam es zum Holocaust und kommt es immer noch zu Kriegen und Verbrechen: der Völkermord in Ruanda, die Roten Khmer in Kambodscha oder die Kriegsverbrechen
im ehemaligen Jugoslawien, mit dem sich das UN-Kriegsverbrechertribunal in diesen Tagen beschäftigt. Die Medien berichten tagtäglich von Anschlägen, Amokläufen und offener Gewalt.
Wie kann es passieren, dass Nachbarn, Bekannte und sogar Freunde die Menschlichkeit vergessen? Blinder Hass, Fanatismus, Gier, Neid – oder einfach schlichte Angst.
Der ehemalige Bundespräsident Johannes Rau hat einmal gesagt: „Nicht jeder, der Angst vor Fremden
hat, ist ein böser Mensch. Ein Fremder macht neugierig, 100 Fremde können Angst machen.“
Ja, Unbekanntes kann Angst machen, deshalb wollen wir mit der „Woche der Brüderlichkeit“ die
Neugier wecken, denn sie ist es, die Menschen immer wieder antreibt, sich dem Unbekanntem zu öffnen.
Befürchtungen, Halbwissen und Gerüchte – sie alle tragen den Keim gefährlicher Vorurteile in sich. Vorurteile grenzen die Betroffenen aus, sie begrenzen aber auch diejenigen, die sie pflegen. Diese Vorbehalte lassen vergessen, dass ein Mensch anderer Herkunft oder Religion vor allem eines ist:
Ein Mensch.
Neugier zu wecken, kann jedoch nur die Voraussetzung im Kampf gegen Vorurteile und Ausgrenzung
sein. Ebenso wichtig ist die Bereitschaft zum Dialog – die Bereitschaft, Einblicke in die eigene Kultur zu geben. Das gilt insbesondere für den Bereich des Glaubens. Der interreligiöse Dialog ist keine Selbstverständlichkeit, er erfordert Mut und die Bereitschaft, andere Standpunkte zuzulassen.
Gleichzeitig ist es das Gespräch miteinander, das die Brüderlichkeit nicht nur zulässt, sondern sie auch charakterisiert. Geschwister sind ja – das wissen wir alle – auch nicht immer einer Meinung. Aber die Besinnung auf die gemeinsamen Eltern ermöglicht es, auch bei unterschiedlichen Standpunkten im Dialog
zu bleiben.
Nicht nur Gemeinsamkeiten gilt es im Gespräch zu entdecken, auch Unterschiede sollen ergründet werden. Dialog darf nicht Schönreden heißen, auch heikle Themen dürfen – ja müssen – angesprochen werden, denn nur ein offener Austausch kann zu Erkenntnissen, Toleranz und gegenseitigem Vertrauen führen.
Es kann bei den Gesprächen nicht darum gehen, welche Religion die bessere oder die wahre sei.
Dies ist eine Frage, die schon seit dem Bestehen der verschiedenen Glaubensrichtungen die Denker und Philosophen beschäftigt hat.
In Lessings Drama „Nathan der Weise“ fragt der Sultan Saladin den Juden Nathan, welche Religion er
für die beste halte. Nathan ist in einer Zwickmühle – weder kann er sein Judentum verleugnen, noch will
er den Herrscher beleidigen. Deshalb erzählt er dem Sultan eine Geschichte:
Ein Vater besitzt einen Ring, der die Eigenschaft hat, seinen Träger vor Gott und den Menschen angenehm zu machen. Da er seine drei Söhne jedoch gleich lieb hat, kann er sich nicht entscheiden, welchem Sohn
er den Ring vererben soll. Deshalb lässt der Vater Kopien des Ringes anfertigen. Nach dem Tod des Vaters streiten sich die Brüder, wer nun den echten Ring habe, da sie keine Wirkung bemerkten. Der Richter gibt ihnen folgenden Rat: Da der echte Ring wahrscheinlich verloren gegangen ist, solle sich
jeder der Brüder bemühen, die Wirkung durch sein Verhalten herbeizuführen.
Die drei Brüder stehen für das Christentum, den Islam und das Judentum. Der Richter rät allen dreien,
sich nicht darauf zu versteifen, die „einzig wahre Religion“ zu „besitzen“. Dies mache sie fanatisch und
vor Gott und den Menschen wenig liebenswert. Jeder solle seinen Glauben für den richtigen halten,
zugleich aber, da jede der drei Religionen ihren Ursprung in Gott habe, andere Glaubensrichtungen tolerieren. Entscheidend sei es, sich so zu verhalten, dass man vor Gott und seinen Mitmenschen als angenehm gilt.
Es geht also in der berühmten Ringparabel um die Bereitschaft zur Toleranz und zu einem Verhalten,
bei dem Gott und die Mitmenschen die Maßstäbe sind.
Und sollte nicht immer die Menschlichkeit der Maßstab unseres Handelns sein? Diese Anschauung ist wahrlich nicht neu. Bereits die Vertreter des Humanismus riefen zur Orientierung an den Interessen, den Werten und der Würde des einzelnen Menschen auf. So auch Pforzheims berühmter Sohn Johannes Reuchlin.
Die Vorstellung, dass Gott und die Menschlichkeit die Maßstäbe des eigenen Handelns sein müssen, ist also keine neue Idee. Umso abstoßender erscheinen viele Ereignisse des letzten Jahrhunderts. All jene Taten, bei denen die Verantwortlichen den Grundsatz von der Zusammengehörigkeit, Gleichheit und Würde aller Menschen bewusst ignoriert haben.
Ich glaube indessen nicht, dass die Idee von der Humanität als Maßstab des eigenen Handelns in der Zeit des Nationalsozialismus vollständig verloren ging. Wohl aber ignorierte sie eine Mehrheit der Bevölkerung, als eine perverse und unmenschliche Ideologie sich zu entscheiden anmaßte, wem die Menschenwürde zusteht und wem nicht.
Wir als nachgeborene Generation können das Geschehene nicht rückgängig machen. Aber dass so etwas nie wieder geschieht, ist das Vermächtnis der Geschichte an uns.
Umso wichtiger ist es, dass wir heute hier versammelt sind und bewusst den Dialog der Kulturen führen. Dies wird in Zukunft noch unerlässlicher werden, da es bald keine Zeitzeugen mehr gibt, die an diese dunkle Epoche der Intoleranz und der Unmenschlichkeit erinnern. Entscheidend ist es, gemeinsam entschlossen gegen Vorurteile und Leugner der Vergangenheit zu stehen.
Ich danke Ihnen.
Copyright:
Alle Rechte vorbehalten. Reproduktionen, Speicherungen in Datenverarbeitungsanlagen oder Netzwerken, Wiedergabe auf elektronischen, fotomechanischen oder ähnlichen Wegen, Funk oder Vortrag – auch auszugsweise – nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors. |