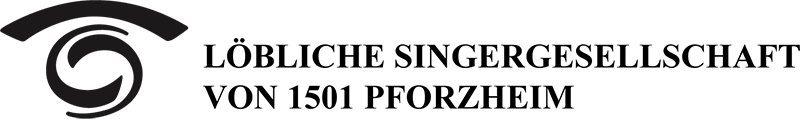|
Unsere Fotos zeigen von links: Die 1948 eingeweihte Auferstehungskirche der ev. Johannesgemeinde Pforzheim ist Architekturgeschichte: sie ist die erste von weiteren 46 Notkirchen, die in kriegszerstörten Städten Deutschlands nach dem 2. Weltkrieg erbaut worden sind. Kunsthistorikerin Claudia Baumbusch (1.v.l.) erläutert bei ihrer Straßenführung von der Glümer- bis zur Bleichstraße die verschiedenen Architekturtypen, die dem Rodviertel sein charakteristisches Gepräge verleihen. Weit über 100 Singer und Gäste der Löblichen Singergesellschaft von 1501 Pforzheim lernten in der 3-stündigen Stadtteilbegehung das Pforzheimer Rodgebiet mit all seinen Facetten kennen. |
Matinee zur Stadtgeschichte
Stadtteilrundgang im Rodviertel
Reportage mit Hintergründen zu Kultur und Geschichte des Pforzheimer Stadtteils
Sonntag, 30. April 2006
mit
Claus Kuge, Obermeister der Löblichen Singer
Claudia Baumbusch, Kunsthistorikerin
Einführung
Bevor das Rodviertel vor rund 100 Jahren seinen heutigen Ruf als Pforzheims Traditionsvillenviertel erhalten hat, war es kein Pforzheimer Stadtviertel, sondern ländlicher Raum mit Gütern, der zur Gemeinde Dillweißenstein gehörte. Im wesentlichen diente der heute teuerste Grund und Boden Pforzheims den Bauern Dillweißensteins als Weide für ihre Kühe.
Der Begriff Rod kommt von Rodung und beschreibt zutreffend, dass im frühen Mittelalter dieses Areal
mit Wald bewachsen war, bevor es gerodet wurde und in Dillweißenstein unter dem Begriff Rod urkundlich festgehalten wurde.
Wohl um 1150 wurde die erste Burg Kräheneck gebaut.
1240-1295 ist urkundlich festgehalten, dass die Herren von Weißenstein den (Neu)Bau der Burg Weißenstein, also der 2. Kräheneck gemacht haben.
1263 besagt eine Urkunde, dass die Herren von Weißenstein Gericht im Hof oder Weiler
Rod gehalten haben.
1454 und 1459 wird in Markgräflichen Lehensbriefen bestätigt, dass
„Zehent, Gross und Klein uff dem Rod“
zum Lehen Weißenstein gehören.
Im 16. Jahrhundert bestätigen Urkunden, dass auf dem Rod die Pforzheimer Häfner „Leimen“ graben dürfen. Mit Erlaubnis des Weißensteiner Burgherren, allerdings nur im Winter, wenn kein Getreide angebaut wird.
Das sagt uns aus, dass der Rod jetzt wirklich gerodet ist.
1583 sind im Dillsteiner Lagerband Pforzheimer Bürger erwähnt, die Grundstücke auf dem Rod haben
und an den Weißensteiner Adel dafür Zins zahlen müssen.
1763 beklagt sich der Weißensteiner Schultheiss weil Pforzheimer Bürger für ihre Liegenschaften
auf dem Rod weder Zaungeld noch Feldhüterlohn bezahlen wollen. Und bittet das Pforzheimer Oberamt diese Gelder zwangsweise einzutreiben.
Am 1. Juli 1777 klagte der Dillweißensteiner Schultheiß Adam Bohnenberger gegen Pforzheim, dass
die Pforzheimer Bauern unberechtigt auf diesem Areal ihre Kühe weiden lassen würden.
Die Pforzheimer wehrten sich mit dem Argument, nach dem Vertrag von 1543 seien sie berechtigt ihre Kühe dort weiden zu lassen.
Bei in Augenscheinnahme wurde festgestellt, dass auf dem Rod keine Grenzsteine zu finden waren.
1785 erhielten die Dillweißensteiner zuerst Recht vor dem Hofgericht, 2 Jahre später jedoch erhielten
die Pforzheimer Recht, weil ihr Stadtschreiber, wie heute bekannt ist, glaubwürdig für das Gericht die Tatsachen wie folgt umschreibt: es sei bekannt, dass Weiherberg und Scheuerberg Bestandteile des Rodes seien und somit sei es logisch, dass Pforzheim Weiderecht auf dem Rod hat, weil Weiderecht
auf dem Scheuerberg besteht und der Scheuerberg zum Weiherberg gehört und der Weiherberg zum
Rod. Q e d = Quod erat demonstrantum. Die armen Dillweißensteiner verloren also nach 8 Jahren
nicht nur den Prozess – sondern mussten auch noch die hohen Prozesskosten aus der Gemeindekasse bezahlen…
1836 ist urkundlich im Separationsstreit zwischen den zusammen gehörenden Gemeinde-Ortsteilen
Dillstein und Weißenstein, dass das Hofgut Dillstein zu einem Dorf umgestaltet ist und durch Ankauf von Gütern auf dem Hof seine Gemarkung erweitert hat. Das Separationsbegehren der Dillsteiner wird jedoch von der Landesregierung abgelehnt.
Bis in die 1850er Jahre blieb das Rod Kuhweide – dann jedoch begann der Bauboom, ausgelöst
vor allem durch Pforzheimer Fabrikanten, die das Rod als ideale Lage betrachteten, große Villen mit großen Gärten dort zu errichten. Diese einflussreichen Großbürger machten Druck auf die Gemeindeverwaltungen von Dillweißenstein und Pforzheim gleichermaßen. Hier kam ihnen zu Hilfe,
dass durch neue Verordnungen des jungen Deutschen Reichs verlangt wurde, Abwasserkanalisationen
in den Wohnvierteln zu verlegen.
So stand Dillweißenstein 1904 vor der Aufgabe für das Rod eine Abwasserkanalisation zu erbauen, Straßen zu verbreitern und mit einer soliden Decke zu versehen. Gleichzeitig brauchte Dillweißenstein
eine Gasversorgung und eine Straßenbahnverbindung zur Stadt Pforzheim. Den Dillweißensteinern war klar, dass sie diese Aufgaben nicht finanzieren konnten, deshalb wollten sie jetzt eingemeindet werden.
Die Pforzheimer Räte jedoch lehnten diesen Antrag ab, weil sie mit den Aufgaben beschäftigt waren,
die die Eingemeindung Brötzingens mit sich gebracht hatten.
1907 verlangten die Pforzheimer Techniker, die mit der weiteren Bebauung des Rod und der notwendig werdenden Entwässerung beauftragt waren, dass sie nun wissen müssten ob Dillweißenstein eingemeindet wird oder nicht. Noch immer drückte sich die Stadtverwaltung um eine klare Aussage, da griffen die Dillweißensteiner zur Selbsthilfe. Pforzheim wollte den Kupferhammer errichten, Dillweißenstein erhob Einspruch dagegen. Unter diesem Druck ließ der OB Habermehl 1908 eine Denkschrift fertigen, die
dem Gemeinderat und dem Bürgerausschuß zur Orientierung über die Eingemeindungsfrage dienen sollte. Diese Schrift zählte Vor- und Nachteile auf, die jede Gemeinde im Fall einer Eingemeindung haben wird. Der einzige Nachteil für Dillweißenstein wurde damit beziffert, dass es seine Eigenständigkeit verliert.
Wesentliche Punkte zum finanziellen Nachteil Pforzheims waren der anstehende Straßenbau und die Kanalisation auf dem Rod und die alleinige Kostenübernahme der Straßenbahnlinie von Pforzheim nach Dillweißenstein, sowie die Gasleitung vom Gaswerk der Stadt auf das Rod und nach Dillweißenstein.
Die Diskussion um die enorme finanzielle Leistung der Stadt Pforzheim die zur Eingemeindung Dillweißensteins zu erbringen war, dauerte noch bis ins Jahr 1913. Also kurz vor dem ersten Weltkrieg
fiel die Entscheidung zur Eingemeindung von Dillweißenstein.
Am 9. Januar 1913 wurde Dillweißenstein mit insgesamt 4.845 Einwohnern und 461 Hektar Land eingemeindet. Vor allem auf Betreiben der Rodgrundbesitzer.
Die Gemarkungstrennlinie zwischen Pforzheim und Dillweißenstein verlief übrigens in der Mathystraße.
Das Rodviertel war schon zu seiner Entstehungszeit auf der Gemarkung Dillweißensteins das moderne Villenviertel Pforzheims.
Es zieht sich als Teil der heutigen Pforzheimer Südweststadt am westlichen Talhang der Nagold herauf.
Symbol seiner urbanen Erschließung ist der 45 m hohe Wasserturm auf dem Rod von 1899.
 |
Der stadtprägende, ca. 45 Meter hohe Turm auf der Anhöhe des Rodrückens wurde 1899-1900 nach Plänen des städtischen Hochbauamtes (Stadtbaumeister Alfons Kern) auf der Dillweißensteiner Gemarkung als Wasser- und Aussichtsturm erbaut |
Mit den Villen namhafter Pforzheimer Fabrikanten verkörpert es als kultivierter und privilegierter bürgerlicher Wohnbereich den Mythos der Goldstadt zur Jahrhundertwende um 1900.
Zu den herausragenden Villen, die heute noch erhalten sind gehören
Villa Beck, Schwarzwaldstraße 7, 1903
Villa Wankel , Friedenstraße 14, 1897
Villa Schütt, Lameystraße 35a,
Villa Rodi, Friedenstraße 58, 1906
Villa Kopp, Lameystraße 61, 1913
Villa Beckh, Lameystraße 67, 1906
Villa Trunk, Friedenstraße 87, 1922
Villa Neumayer, Friedenstraße (95-111), 1922
Villa Brinkmann, Bichlerstraße, Augenarzt 1897
Zu den französischen Straßennamen im Rod
Die Adresse der Auferstehungskirche in Pforzheim lautet: Goebenstraße 2.
August von Goeben (1816-1880) war Preußischer General. Er war im deutsch-französischen Krieg (1870-71) der kommandierende General des VIII. Armeekorps.
Nicht nur der Straßenname – Goebenstraße – erinnert im Rod an den deutsch-französischen Krieg von 1870/71 sondern weitere zahlreiche Straßennamen:
wie z.B.
Nuitsstraße,
Etivalstraße,
Dijonstraße,
Belfortstraße,
Vogesenallee,
alles Straßennamen, bei denen vor allem badische Truppen in verlustreichen Kämpfen gegen eine große Übermacht der Franzosen den drohenden Einfall des Gegners in ihre Badische Heimat verhinderten.
Die Namen Steinmetz-, Glümer-, Goeben-, und Kirchbachstraße lassen die Namen damals bekannter Heerführer noch heute weiterleben. Elsässer-, Weißenburg-, Spichern- und Gravelottestraße stehen wie Straßburgerstraße stellvertretend für weitere Kämpfe, die die Badener geführt haben.
So sind noch heute 135 Jahre später diese Straßennamen Erinnerung an die Schlachten der Deutschen gegen die Franzosen. Auch der Sedanplatz erinnert an die siegreiche Schlacht von Sedan vom 1.+ 2. September von 1870. Und zum 25-jährigen Gedenken an die Errichtung des Deutschen Reichs und dem Frankfurter Frieden vom 20. Mai 1871 wurde die Friedenstraße 1896 Friedenstraße getauft.
Man muss sich vor Augen halten, schreibt der Pforzheimer Chronist Oskar Trost (1882-1972) dass für unsere Väter und Großväter der Krieg von 1870/71 und die Errichtung des neuen deutschen Reiches einfach das Erlebnis ihrer Zeit war. Der jahrzehnte-, ja – jahrhunderte alte Traum der Einigung Deutschlands schien damit seine endgültige Erfüllung gefunden zu haben. Und so fühlen sie sich gedrungen die Erinnerung an dieses Erlebnis für ewige Zeiten festzuhalten. Uns sind als Erinnerung an diese geführten Schlachten heute der Sedanplatz und die erwähnten Straßennamen im Rodgebiet geblieben.
Um allerdings nochmals Oskar Trost zu zitieren: „diese kriegerische Tradition passt zu diesem friedlichen Viertel eigentlich gar nicht.“
Bild links: Claudia Baumbusch erklärte den über 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Führung durch das Rodgebiet die verschiedenen Bautypen, die das historische Bau-Areal des Rod kennzeichnen:
1. die genossenschaftlichen Mehrfamilien-Arbeiterwohnhäuser, die charakteristisch u.a. in der Genossenschaftsstraße und der Glümerstraße zu sehen sind. Sie zeichnen sich durch mehrgeschossige Bauweisen aus. Und wurden in den 1870er Jahren mit Unterstützung der Pforzheimer Fabrikanten gebaut, um ihren Arbeitern menschwürdige Unterkünfte zu geben. Hierzu wurde 1871 eigens die „Baugenossenschaft Pforzheim“ gegründet. Sie gehörte zu den frühesten Baugenossenschaften Deutschlands
2. Das Rodviertel mit vor allem zu Beginn der Friedenstraße auch durch hochwertige villenähnliche Mehrfamilienhäuser geprägt, diese Wohnungen standen leitenden Mitarbietern der Schmuckindustrie z.B. Direktoren als repräsentative Wohnungen zur Verfügung. Fotos links und rechts oben.
3. In den großbürgerlichen Villen auf dem Rod, die das Bild vor allem von Friedenstraße und Lameystraße prägen, spiegeln sich die einzelnen Epochen des sich wandelnden Architekturgeschmacks des späten 19. Jahrhunderts wider. Wir finden hier u.a. neoklasizistische Bauten, neogotische und neobarocke Baustile, sowie Jugendstilbauten in allen Interpretationen und Stilmischungen, bis zur Interpretation mit lokalen oder regionalen Stilelelementen. Eine besondere Spezialität sind die noch erhalten gebliebenen ganz großen Villen, die im Pforzheimer Volksmund „Schlössle“ bezeichnet worden sind. Dies sind Bauten, die teilweise an verkleinerte französische Schlösser oder mittelalterliche Burgen erinnern.
Die Außenformen der neu entstandenen Villen im Zeitalter des um die 1900-Jahrhundertwende bestehenden Zeitgefühls des Historismus zeichnen sich in den Fassaden dadurch aus, dass viel Wert auf das Fassadenbild gelegt wurde, das zur Straßenseite hin entsteht und andererseits hat die Rauminnenarchitektur wesentlich das vielfältige Fassadenbild nach außen geprägt.
Die Friedenstraße wurde ab 1891 gemeinsam mit der Lamey-, Mathy- und Glümerstraße abschnittsweise angelegt und bildet das Rückgrat des Rodviertels, das im Zuge der Stadterweiterungsplanung um 1895/96 als privilegierte „fabrikfreie Zone“ ausgewiesen wurde. Der Straßenname wurde 1896 vergeben in Erinnerung an das 25jährige Jubiläum des Kriegsendes des deutsch-französischen Kriegs und der Gründung des neuen deutschen Kaiserreichs. Die Bebauung der Friedenstraße mit Stadthäusern und Villen begann um 1900 mit der Blühtezeit der Schmuckindustrie. Im mittleren Abschnitt ist uns die Friedenstraße als geschlossenes Jugendstil-Ensemble erhalten geblieben – während im Nordabschnitt durch Kriegszerstörung erhebliche Lücken in der ursprünglichen Bebauung entstanden sind, die heute mit stylistisch unpassenden Neubauten aus den 1950er und 1960er Jahre geschlossen worden sind.
Nach der Eingemeindung Dillweißensteins im Jahr 1913 wurde die Friedenstraße von der Vogesenallee ausgehend über die jetzt aufgehobene Gemarkungsgrenze hinaus verlängert und folgt dem Talbogen bis an die „Steinerne Brücke“ beim Ludwigsplatz.
Der Kern des Rodviertels steht mit Gemeinderatsbeschluss seit 28. März 1994 insgesamt unter Denkmalschutz.
Bild links: Friedenstraße 10/12, das villenähnliche Wohndoppelhaus wurde 1906 nach Plänen des Pforzheimer Architekten Fritz Böhm für den Fabrikdirektor Georg Haas und den Planverfasser selbst errichtet. Der sonst in Pforzheim nicht in Erscheinung getretene Architekt Fritz Böhm gestaltete dieses ansprechende Doppelhaus, dessen Jugendstilformen auf ländliche Vorbilder anspielen. Als geschlossene Gruppe mit Ensemblewirkung erinnern die Gebäude Nr. 10/12 (Bild links), 14/16 (Bild rechts) und 18 (Foto unten) an den Ausbau des Rodviertels im späten wilhelminischen Kaiserreich.
Bild links: Friedenstraße 14/16, das 2-geschossige Wohndoppelhaus wurde 1899-1900 nach Plänen des Architekten und Bezirksbaukontrolleurs Albert Rau (Pforzheim) auf eigene Rechnung erbaut. Dieses Doppelhaus dokumentiert die Anfänge der Bebauung der Friedenstraße und des Rodviertels. Die späthistorischen Stilformen sowie das Baudatum sind hierfür Zeugen. Im kunsthandwerklichen Aufwand veranschaulichen sich die damaligen Erwartungen eines bürgerlichen Publikums, für das das Villenviertel konzipiert wurde.
Fotos rechts: zeigt als 2. Haus von links die Friedenstraße 18, die ehemalige Villa Zügel, die 1907 nach Plänen des Architekten Theodor Preckel sen. für den Metzgermeister Richard Zügel errichtet wurde.
Bild links: zeigt das original-erhaltene Eingangstor zum Wohnhaus Schär – das sogenannte „Eselsjoch“ wurde nach mittelalterlichem historischen Vorbild um die Jahrhundertwende aus lokalem Sandstein gefertigt. Sehr schön sind auch die schmiedeeisernen Arbeiten von Tür und Gartenzäunen.
Bild rechts: Friedenstraße 18, das villenartige Wohnhaus wurde 1907 nach Plänen des Architekten Theodor Preckel sen., Pforzheim, für den Metzgermeister Richard Zügel errichtet. Als beispielhaftes Werk des überregional beachteten Pforzheimer Architekten Theodor Preckel sen. (1877-1924) wurde die „Villa Zügel“ 1909 in einer Bauzeitschrift vorgestellt. Der Verlust einiger Fassadendetails wird durch die überlieferte Ausstattung aufgewogen.
Bild links: Friedenstraße 40, diese Villa wurde 1905 nach Plänen des Architekten Hermann Neutz (Pforzheim)
für den Privatier Valentin Beck erbaut. Das mit dem Anspruch einer Villa gestaltete Wohnhaus bezeugt in seinen kunsthandwerklichen Dekorationsformen den Übergang vom Historismus zum Jugendstil sowie den damaligen Ausbau des Rodviertels.
Bild rechts: Friedenstraße 44/46, dieses Wohndoppelhaus wurde 1906 nach Plänen des Pforzheimer Architekten
Otto Deyhle für den Fabrikanten August Schmiedt erbaut. Das Doppelhaus, das nach einer gemeinsamen Planung mit Friedenstraße 48 entstand, ist Bestandteil eines größeren Ensembles der Zeit um 1910 und dokumentiert mit seinen Veränderungen das Ereignis von Kriegszerstörung und Wiederaufbau.
Bilder von links: Friedenstraße 58, diese vornehme Villa prägt als Eckgebäude zur Nuitsstraße mit Eckturm das Straßenbild. Sie wurde 1906 nach Entwürfen des Pforzheimer Architekten Heinrich Deichsel für den Schmuckfabrikanten Eugen Rodi errichtet. Die aufwendig gestaltete Villa Rodi, im Volksmund auch als „Schlössle“ bekannt, betont mit ihrem dominanten Eckturm ihren stadtbildprägenden Standort am Schnittpunkt mehrer Straßen im Villenquartiert. Sie gehört zu den wichtigsten Werken des überregional beachteten Pforzheimer Architekten Heinrich Deisel (1872-1954). Unübersehbar ist die stilistische Verwandschaft mit der neogotischen Architektur des Douglas’schen Schlosses in Gondelsheim (Kraichgau). Die künstlerische Nähe zum Karlsruher Jugendstilachitekten Hermann Billing lässt sich anhand des von Billing & Zoller ausgeführten Interieurs belegen. Die mit ihrer Ausstattung erhaltene Villa demonstriert eindrucksvoll die gestalterische und handwerkliche Sorgfalt, mit der damals architektonische und bildhauerische Details, individuelle Räume und Ausstattungen entworfen und ausgeführt wurden. Sie veranschaulicht die repräsentative großbürgerliche Lebensart des Fabrikantenbürgertums in der späten wilhelminischen Epoche. Die „Autohalle“ dürfte landesweit zu den frühesten gehören. Die Bezeichnung „Villa Rodi“ erinnert an den Schmuckfabrikanten Eugen Rodi, Teilhaber der bedeutenden Pforzheimer Schmuck- und Uhrkettenfabrik Rodi & Wienenberger.
Bild links: Friedenstraße 62 (ehemalige Villa Knoll), diese zweigeschossige Villa wurde 1913/14 nach Plänen des Architekten Victor Krauß, Pforzheim, für den Bauunternehmer Gottlieb Krauß erbaut. Die Villa bezeugt beispielhaft die stilistische Entwicklung der Reformarchitektur um 1910 und den damaligen Ausbau des Rodviertels zum bürgerlichen Villenviertel.
Bild rechts: Friedenstraße 77, die bildprägende Villa wurde 1907 nach Plänen des Pforzheimer Architekten Karl Faller für Karl Armbruster erbaut. Das Haus präsentiert sich als malerisches Landhaus im regionaltypischen Jugendstil der ausgehenden wilhelminischen Epoche.
Bild links: Lameystraße 67 (Einmündung der Lameystraße in die Friedenstraße), ehemalige Villa Beckh, wurde 1906 nach Entwürfen des Pforzheimer Architekten Theodor Preckel sen. für den Fabrikanten Christian Karl Beckh erbaut. Die ehemalige Fabrikantenvilla Beckh bildet ein frühes Hauptwerk des aus Köln gebürtigen Pforzheimer Architekten Theodor Preckel sen. (1877-1924). Ihre Formgebung im französisch anmutenden Palaststil eines barocken Historismus gehört zu den regional herausragenden Beispielen der Villenbaukunst der wilhelminischen Epoche. Größe und kunsthandwerkliche Ausstattung des Hauses dokumentieren ebenso wie die Verbindung mit dem „Kutscherhaus“ anschaulich den großbürgerlichen Lebensstil der damaligen Zeit. Das stadtbildprägende Anwesen besitzt damit für den Ausbau des Rodviertels und die Blütezeit der Goldstadt besondere Bedeutung.
Die Villen in der Bichlerstraße mit ihren typischen regionalen Historismus- und Jungendstilfassaden sind um 1900 entstanden. Die Bichlerstraße galt damals als Verlängerung der Bleichstraße. Sie trägt ihren Namen nach dem Schmuckfabrikanten und Landtagsabgeordneten Eduard Bichler (1819-1899), dem Mitbegründer des Pforzheimer Verschönerungsvereins, einem historischen Vorläufer unserer heutigen Bürgervereinigung „Pforzheim mitgestalten“. Der Verschönerungsverein hatte damals u.a. den Davoswiesenweg angelegt, dessen alter Baumbestand uns heute wohltuend an heißen Sommertagen Schatten spendet auf dem Spaziergang vom Davoswiesenweg-Kiosk nach Dillweißenstein.
Unsere Fotos oben zeigen die Bichlerstraße 12, die ehemalige Villa Dr. Brinkmann. Sie wurde 1897 für den
Augenarzt Dr. Albrecht Brinkmann vom Pforzheimer Architekten Ernst Maler erbaut. Maler gilt als wichtigster lokaler Architekt des Gründerzeitlichen Historismus.
Dem Bombenangriff vom 23. Februar 1945 fiel der vordere Teil der Bleichstraße vom Sedanplatz bis zur Einmündung Oberen Rodstraße komplett zum Opfer. Dagegen blieb der hintere Teil der Bleichstraße bis zur Lisainestraße fast unbeschädigt erhalten.
Ihren Namen hat die Bleichstraße schon im Mittelalter durch das dort angesiedelte Bleichergewerbe am Metzelgraben erhalten. In den 1860er Jahren wurde die Bleichstraße ausgebaut – unter anderem hat die dort durchführende Straßenbahn die Innenstadt mit diesem damaligen Pforzheimer Randbezirk der Stadt verbunden. Die noch erhalten gebliebenen Bauten mit geraden Hausnummern sind Zeugnisse des hochwertigen Wohnbaus, teilweise mit komplett erhalten gebliebenen Jugendstilfassaden. Wohin gegen die erhalten gebliebenen Bauten mit ungeraden Hausnummern größtenteils dem Genossenschaftlichen Bauwesens Pforzheims entstammen und insgesamt schlichte Arbeiterwohnungen waren.
Unsere Fotos unten zeigen Kontor und Fabrikationsgebäude der damalig weltgrößten Schmuckwarenfabrik Kollmar & Jourdan, die um 1900 bis zu 2000 Arbeitern beschäftigte. Kontor und Fabrikation wurden durch eine Fußgängerbrücke über die Hans-Meid-Straße verbunden. Im ehemaligen Fabrikationsgebäude befinden sich u.a. das technische Museum der Stadt Pforzheim und die Pforzheim Galerie. Auf der Fassade des Kontorgebäudes von K&J befinden sich 5 sehenswerte Originalmajolika der Karlsruher Majolika-Manufaktur, jede fast 1 m im Durchmesser. Die für K&J eigens gefertigten „Kunstwerke“, deren Designer uns unbekannt ist, symbolisieren die weltweiten Geschäftsverbindungen des Hauses K&J in Form von stylisierten Abbildungen der 5 Erdteile.
Zur Auferstehungskirche:
„Seht diese Konstruktion, sie ist ein Zelt in der Wüste“, meinte der Architekt Bartning 1949.
Jetzt begeben wir uns auf eine Zeitreise vom deutsch-französchischen Krieg (1870/71) zum 2. Weltkrieg.
Die Auferstehungskirche im Rodviertel wurde als Notkirche nach dem schrecklichen Ende des 2. Weltkriegs und gleichzeitig als Mahnmal zum 2. Weltkrieg errichtet:
Der für Pforzheim mit der fast kompletten Zerstörung der Stadt am 23. Februar 1945 geendet hat.
Über 20.000 Menschen waren binnen einer Stunde in der Pforzheimer Innenstadt jämmerlich verbrannt und erstickt. Auf der noch bis dahin mittelalterlichen Bausubstanz der Kern- und Innenstadt Pforzheims stand kein Stein mehr auf dem anderen. Architekt Bartning hatte also eine Trümmerwüste vor seinen Augen, als er vom Rod auf die zerstörte Innenstadt blickte.
Auch die innerstädtischen Kirchen, außer der kath. Franziskuskirche, waren zerstört.
Die Zerstörung Pforzheims endete dort, wo die Obere Rodstraße von der Bleichstraße abzweigt.
Das heißt, das heute in seinem Kern denkmalsgeschützte Rodviertel, durch das uns nachher Frau Baumbusch führen wird, bleibt verschont. Das Gründerzeit-Viertel Rod bleibt uns somit ursprünglich erhalten und ist heute markantester steinerner Zeuge der ersten industriellen Blütejahre unserer Traditionsindustrie in der Goldstadt. Die explosionsartige Industrialisierung Pforzheims in kurzer Zeit machen die Einwohnerzahlen der Stadt am besten deutlich:
1810 waren es 5.572 Einwohner
1910 waren es 69.082 Einwohner
Doch zurück nach 1945
Der starke Zuzug von Einwohnern der kriegszerstörten Talstadt ins Rodviertel veranlasste die evangelische Gemeinde Pforzheims zum Bau eines dringend benötigten Gotteshauses.
Die Menschen hatten kein Dach über dem Kopf, es fehlte am Nötigsten und vor allem auch am Geld,
eine Kirche zu bauen.
So entwickelte der in Neckarsteinach wohnhafte, Karlsruher Architekt Otto Bartning sein Konzept der Notkirche. Die Notkirche ist aber auch gleichzeitig als Mahnmal gegen den Krieg gedacht.
Die Pforzheimer Auferstehungskirche ist der erste deutsche protestantische Kirchenneubau nach dem
2. Weltkrieg. Und Prototyp des „Notkirchen-Programms“. Damals fehlte es nicht nur an Geld, sondern auch an Baumaterial…
… „so musste Stein hier unverputzter Stein,
Holz gewachsenes Holz
und Stahl unverkleideter Stahl sein“
sagte Otto Bartning treffend in seiner Ansprache bei der Einweihung seiner ersten Notkirche Deutschlands.
Der Pforzheimer Auferstehungskirche folgten 46 weitere Notkirchen in kriegszerstörten Städten ganz Deutschland, auch in der … späteren … DDR, also im vom Sowjet-Russland besetzten Osten Deutschlands.
Die letzte Notkirche, als Weltkrieg 2-Folge, entstand 1952 in Wismar.
1969 erinnert man sich in Wehrendorf an dieses Notkirchenkonzept.
Allerdings mit anderen Vorzeichen. Die Wehrendorfer bauen die 1951 in Bad Oeynhausen von Bartning errichtete Notkirche ab und stellen sie in 1969 als Kreuzkirche in Wehrendorf wieder auf.
Das Bartning’sche Konzept „Notkirche“ wurde im Auftrag des Hilfswerks der Deutschen Evangelischen Kirchen in Deutschland entwickelt. Das Projekt fand die Unterstützung des ökumenischen Weltrats der Kirchen in Genf und damit konnten für den Bau der deutschen Notkirchen Spendengelder aus dem Ausland gesammelt werden.
Die architektonische Grundlage der Notkirche war stets das seriell vorfabrizierte Grundgerüst aus Holzbindern, das auf der jeweiligen Baustelle lediglich end-montiert wurde. Die Holzkonstruktion ist der tragende Teil der Kirche. Die nichttragende gemauerte Außenhülle wurde der jeweiligen örtlichen Notsituation entsprechende durch die jeweilige Kirchengemeinde und ihre Mitglieder Stein um Stein in Eigenleistung aufgemauert.
So auch in Pforzheim. Wo die Überlieferung eines Mitglieds der Bautruppe wie folgt erhalten
geblieben ist:
„30.000 Backsteine haben wir ausgegraben, gesammelt, geputzt und mit Leiterwagen zum Bauplatz gefahren. Darunter auch große Sandsteine, die noch die Brandspuren vom 23. Februar 1945 an sich trugen.“
Das Holz-Gestänge im Innenraum erinnert bewusst an das Gestänge eines großen Zeltes.
Laut Bartning sollen unter diesem Zeltdach der Kirche die Menschen Schutz und Geborgenheit nach
ihren schrecklichen Kriegserlebnissen finden.
Übrigens: nicht nur Konstruktion und architektonische Form der Kirche stammen von Otto Bartning
– nach seinen Entwürfen wurden Altartisch und der Taufstein in Kreuzform gestaltet.
Am 8.5.1946 war offizieller Baubeginn, die Grundsteinlegung am 22.5.1947.
Die Einweihung war am 24.10.1948
Grundsätzlich wurden alle Notkirchen in sehr kurzer Bauzeit, in der Regel in 1-2 Jahren erstellt.
Bartning selbst hat damals daran erinnert, dass der traditionelle große Kirchenbau oft bis an die hundert Jahre gedauert hat…
Jetzt zum atmosphärischen Herzstück der Auferstehungskirche, den Fenstern:
Das ursprüngliche schlichte Klarglas-Fensterband wurde 1966 durch die markante Buntverglasung
des Karlsruher Künstlers Prof. Klaus Arnold ersetzt. Der 1928 geborene Professor für Malerei und
Grafik an der Kunstakademie in Karlsruhe hatte in Venedig studiert und in Murano seine Kenntnisse im Umgang mit Glas vertieft. Seine Erfahrung als Maler bestimmte seine Arbeit an den eindrucksvollen Glasfenstern. Das Design stellt symbolhaft abstrakt die Drei-Einigkeit Gottes dar.
Gut gefüllt war der Kirchenraum der Auferstehungskirche mit Singern und Gästen, die die Auferstehungskirche im Zug der Stadtteilbegehung Rod besichtigt haben.
1966 hat Prof. Klaus Arnold die innenraumprägenden Glasfenster gestaltet.
Das Foto links zeigt den Altarraum – das Fotos rechts zeigt den Löblichen Singer und Kantor der Johannesgemeinde bei seinem Vortrag zur Walcker-Popp-Orgel, die er anschließend erklingen ließ…
Verflechtung von Farbinseln ineinander und starke Lichtkompositionen sind Merkmale seiner
meisterlichen Arbeit in der Auferstehungskirche.
Die Glasfenster von Prof. Klaus Arnold sind einer der drei Höhepunkte im Innenraum der Kirche.
Die anderen zwei sind:
das Kruzifix
und
die Walcker-Popp-Orgel.
Zum Kruzifix
Das künstlerisch einzigartige gotische Bildwerk ist nach Mathias Köhler der Werkstatt des bedeutenden Ulmer Bildhauers Hans Multscher (1400-1467) zuzuschreiben. Es ist vermutlich in den 1440er Jahren entstanden. Es zeigt den leidenden Christus mit seitlich geneigtem Haupt, schulterlangem Haar und Dornenkrone in eindringlich-realistischer Darstellung. Glaubwürdiger mündlicher Überlieferung zufolge stammt dieses herausragende Kunstwerk aus dem Pforzheimer Dominikanerkloster St. Stephan, in
dessen Hof es in nachreformatorischer Zeit noch aufgestellt war. 1899 gelangte es in die neu erbaute Stadtkirche am Lindenplatz. Wie durch ein Wunder überstand das Kruzifix alle vier Stadtbrände (1689, 1692, 1789, 1945) Zum Kruzifix gehört als Sockel ein Standsteinreliefblock mit dem allegorischen „Golgatha“-Motiv, der von 1949 bis 2004 in die Mauer des Kirchvorplatzes am nördlichen Treppenaufgang integriert war. Und sich heute unter dem Kreuz, hinter dem Altar, befindet.
Bevor ich näher auf die Christusfigur eingehe, möchte ich auf den Sandsteinblock Golgatha eingehen:
Der Sandstein zeigt ein Tier mit geringeltem Schwanz, auf beiden Seiten eingerahmt von Menschlichen Schädeln. Diese Komposition bezieht sich vordergründig auf den Ort der Kreuzigung
Golgatha = Schädelstätte
der tiefere Sinn spielt aber auf die Überwindung von
Sünde = Untier
und
Tod = Schädel
durch den Kreuztod von Christus an.
Das Foto zeigt den Golgatha-Stein, auf den das Kreuz gestellt ist.
Ursprünglich saß der spät-mittelalterliche Holz-Kreuzesstamm direkt auf dem Untier auf. Die Schlange
des Paradieses, die dem ersten Menschenpaar Adam und Eva das Verderben durch die Vertreibung aus dem Paradies brachte, ist damit symbolisch überwunden. Der „alte Adam“ ist damit erlöst.
Jetzt zum Kreuz:
Es besteht aus Laubholz. Nicht mikroskopisch untersucht, ob aus Lindenholz oder Weidenholz.
Das Kreuz selbst ist, obwohl es massiv wirkt, aus Brettern zusammengefügt.
Der Christus ist 133 cm hoch, 28 cm breit.
Die Armspannweite beträgt 118 cm.
Aus den 1440er Jahren stammt das Kruzifix, das 4 Brände in Pforzheim überstanden hat.
Das Kreuz wurde 1948 von Oskar Loss restauriert, wobei sämtliche Fassungen abgelaugt, die beiden Arme mit veränderter Handhaltung erneuert wurden und auch das Kreuz wurde damals erneuert.
Schäden aus den Bränden sind jedoch noch sichtbar. Die Wiederherstellung des Kruzifixes stifteten damals Pfarrer Dr. Oskar Schuhmacher und seine Frau Elisabeth zum Gedächtnis an die heimgegangenen Eltern Fritz Schuhmacher und dessen Frau Emilie geb. Pfankuchen zur Einweihung der Johanneskirche 24.10.1948.
Anatomische Genauigkeit, Individualisierung der Gesichtszüge und schnitztechnische Raffinessen bei der Behandlung der Haare, kurz das Streben nach Realismus zeichnen dieses spätmittelalterliche Kunstwerk aus.
Das durch 4 Feuer gegangene Kruzifix war in der 1899 neu erbauten Stadtkirche am Lindenplatz zum Pforzheimer Hoffnungszeichen damals zeitgenösssisch mit folgendem pathetischen Spruch stilisiert worden, der sich neben dem Kruzifix an der Wand der Stadtkirche bis 1945 befand:
„Vom alten Kirchplatz hierher versetzt,
bei den Bränden 1692 und 1798 wunderbar erhalten,
ein treues Wahrzeichen und Altertum Pforzheims.
Gewechselt habe ich den Ort
doch segne ich fort und fort
die Flamme schadet mir nicht
ich zeuge von Liebe und Licht“
Ein paar Worte zur Geschichte der Kirche
1948
Gemeindemitglieder stiften die „Christus-„ und die „Johannesglocke“.
und
Der hintere Teil der Kirche war durch Falttüren abtrennbar und diente damals als Kindergarten.
1954
Der Kirchturm wird aufgestockt.
1956
Die Walcker-Orgel wird installiert.
1967
Das Bankgestühl wird erneuert.
und
Die „Melanchthon-Glocke“ aus der kriegszerstörten Stadtkirche mit der Innschrift „gegossen im Jahr 1922 von Gebrüder Bachert Karlsruhe in Baden“ und die „Gedächtnisglocke 23. Februar 1945“ und die „Adventsglocke“ werden von Fritz Ungerer gestiftet.
2005
Die Walcker-Orgel wird durch den Orgelbauer Popp komplett renoviert.
und
es entstehen im Reuchlinjahr Überlegungen, ob der Glockenstuhl außer der „Melanchthonglocke“ eine „Reuchlinglocke“ last- und klangmäßig ertragen kann.
Jetzt zur Vita und Philosophie des Architekten Otto Bartning:
Nach dem Abitur 1902 in Karlsruhe begann Otto Bartning im Wintersemester des gleichen Jahres sein Studium an der Königlichen Technischen Hochschule zu Berlin. Ab März 1904 unternahm Bartning eine anderthalbjährige Weltreise und setzte dann sein Studium in Berlin und Karlsruhe fort. Gleichzeitig jedoch war er bereits am Ende 1905 freischaffender Architekt in Berlin. So kam es vermutlich, dass er sein Studium ohne Abschluss beendete.
Zusammen mit Walter Gropius entwickelte Bartning ab Ende 1918 die Bauhausidee, formulierte weitgehend das Programm, war dann aber doch nicht an der Umsetzung beteiligt … Gropius setzte die Idee im Alleingang im weltberühmten Bauhaus in Dessau um. Bartning war 1926-30 Direktor der neu gegründeten Bauhochschule in Weimar. Danach war er vorwiegend wieder in Berlin als Architekt tätig. Nach dem Krieg in Neckarsteinach und Darmstadt. Nach dem Krieg war er u. a. maßgeblich beteiligt an der Wiederbegründung des Deutschen Werkbundes und ab 1950 dessen 2. Vorsitzender, ab 1950 auch Präsident des Bundes Deutscher Architekten. Bartning starb 1959 in Darmstadt, wo sich heute auch das Otto-Bartning-Archiv befindet.
Lassen Sie mich zum Schluss auszugsweise aus der Rede Otto Bartnings beim Festgottesdienst seine Gedanken zur Einweihung der Notkirche in Pforzheim am 24. Oktober 1948 wie folgt
und passend in einem Kirchenraum
zitieren:
Das Zelt in der Trümmerwüste
„Aus Trümmern sind diese merkwürdigen Mauern gebaut worden. Wir gedenken der unseligen 30 Minuten, da diese blühende Stadt unter den Hammerschlägen der gepriesenen Technik in Trümmern fiel… Diese Kirche in der Wüste … Wenn aber zwei oder drei in der Wüste sich treffen und am besonderen Blick der Augen sich erkennen, so bleiben sie beisammen … Solche Gemeinschaft in der Wüste aber wird einen Ring von Steinen legen und wird ein Zelt bauen, nicht nur um den Ort des Zusammenseins zu sichern, sondern um diese ihre Gemeinschaft des Geistes sichtbar und also auch in den Sinnen wirksam zu machen. Sehet, diese vom Boden auf zueinander geneigte und zum Rund sich schließende Holzkonstruktion, sie ist ein solches Zelt in der Wüste. Und wir wissen, dass gerade in der Wüste, in der Angst und Verwirrung der Seelen die klare Ordnung, die Einfalt und bedingungslose Ehrlichkeit dieses Zeltes von wirklicher Bedeutung sind.“
Kurze Geschichte der Walcker und der Walcker-Popp-Orgel
Dass die Auferstehungskirche bereits acht Jahre nach ihrer Fertigstellung eine vollwertige Pfeifenorgel erhalten hat, war in den finanziell wenig rosigen 50er Jahren keine Selbstverständlichkeit.
1956 hat die Orgelbau-Firma Walcker aus Ludwigsburg unsere Orgel mit 26 Registern eingebaut. Architektonisch sehr gelungen gelöst ist der Einbau um das runde Kirchenfenster, das durch seine blaue Farbigkeit der Orgelempore ein ganz besonderes und meditatives Flair verleiht.
Jetzt im 21.Jahrhundert, in dem wie vor 50 Jahren die Finanzsituation angespannt ist, muß die Johannesgemeinde ihre Orgel renovieren um den Kirchenraum der Auferstehungskirche wieder volltönig mit Klang zu erfüllen.
Die Technik
Zum besseren Verständnis folgt hier eine kurze Information über die wichtigsten Teile einer Orgel.
Orgelmotor, Gebläse und Blasebalg sorgen für die Winderzeugung, wobei dem gleich bleibenden Luftdruck erhebliche Bedeutung zukommt. Windladen sind im Prinzip Luftkammern, die die Zufuhr von Luft zu den Pfeifen gewährleisten. Darunter liegen Ventile, die für den Zustrom der Luft in die Pfeife sorgen, sobald eine Taste gedrückt wird.
Die Orgelpfeifen, zur Tonerzeugung durch die von den Windladen einströmende Luft, sind teils aus Holz (meist Fichte), teils aus Metall (Zinn oder Kupfer).
Die Register, die verschiedene Klangfarben ermöglichen sind Vereinigungen von Pfeifen gleicher Bauart. Sie werden am Spieltisch aus und eingeschaltet. Ihre Namen kennzeichnen oft ihre klangliche Eigenart, z.B. Rohrflöte oder Trompete.
Der Bewegungsimpuls von der Orgeltaste zum Ventil unter der Pfeife erfolgt bei der Orgel über lange dünne Holzstäbe, die Abstrakten.
Der Spieltisch enthält die Tastatur und die Registerschaltungen.
Zur Nutzung der klanglichen Vielfalt dienen die Manuale, übereinander angeordnete Tastaturen für die Hände, sowie das Pedal, eine Holztastatur für die Füße. Die Orgel der Auferstehungskirche hat
2 Manuale.
Die Renovierung
Wie bei einer Waschmaschine, einer Spülmaschine oder bei einem Auto treten im Laufe der Jahre bei
einer Orgel Abnutzungserscheinungen auf. Der Hauptverschleiß liegt bei der Orgel der Johannesgemeinde im Windladensystem, ohne das keine Luft zur Pfeife gelangt. Alle belederten Teile sind in einem maroden Zustand, sodass störende Pfeifgeräusche entstehen. Diese werden sich noch verstärken. Eine grundlegende Erneuerung ist unumgänglich. Sie stellt den aufwendigsten Teil der Erneuerung dar. So wird statt des in den ersten Nachkriegsjahren angewendeten Systems ein Schleifladensystem eingebaut, das haltbarer sein wird und klangliche Verbesserungen bringt. Die Klaviatur, also die Tasten, auf denen gespielt wird; ist inzwischen völlig ausgespielt, gleichsam „ausgeleiert“. Auch hier sind fachmännische Reparaturen erforderlich.
Manche Pfeifen sind in schlechtem Zustand und müssen teilweise neu gegossen werden.
Einige Abstrakten, bewegliche Holzstäbe zwischen Taste und Pfeife, biegen sich durch sodass der Impuls von der Taste zur Pfeife verzögert wird und exaktes Spielen unmöglich wird. Sie müssen erneuert werden.
Schließlich werden einige Register ersetzt zugunsten einer besseren Tragfähigkeit des Orgelklangs im Kirchenraum.
Information zu den Kosten der Renovierung
Die Gesamtreparaturkosten waren 80.000,00 € veranschlagt.
Die Landeskirche und die Pforzheimer Kirchengemeinde übernehmen 50 %, also je 40.000,00 €
Die Johannesgemeinde musste daher ebenfalls 40.000,00 € aufbringen.
Am Festgottesdienst am 04.12.2005 stellte der Pfarrer der Johannesgemeinde, Wolfgang Stoll, in seinem Bericht fest, dass durch eine gelungene Spendenaktion durch die Gemeindemitglieder der Johannesgemeinde und Freunde und Gönner der Auferstehungskirche insgesamt rund € 53.841 gespendet worden sind.
Die Kosten der Renovierung waren mit € 93.000 höher als geplant und vorhersehbar – deshalb reichte das hohe Spendenvolumen gerade aus, um die Mehrkosten abzudecken.
Grund für die Mehrkosten: der wirkliche Zustand der Orgelpfeiffen zeigte sich erst bei Herausnahme, nicht bei Inaugensteinnahme durch den Orgelbauer.
Es gilt das gesprochene Wort von Claus Kuge für den Vortrag über die Geschichte des Rodviertels und die Auferstehungskirche .
Für den Vortrag während der Straßenführung (Glümer-, Friedens-, Bichler- und Bleichstraße) durch Claudia Baumbusch existiert von ihr keine schriftliche Fassung.
Die wichtigsten Stationen haben wir in Wort und Bild wiedergegeben unter teilweiser Verwendung von Originaltexten von Dr. Christoph Timm aus dem Buch „Pforzheim – Kulturdenkmale im Stadtgebiet“. Dieses Buch wurde von der Stadt Pforzheim und dem Landesdenkmalamt Baden-Württemberg im Jahr 2004 gemeinschaftlich herausgegeben.
Aufgrund der bestehenden Cooperation zwischen der Stadt Pforzheim und den Löblichen Singern hat die Internetredaktion der Löblichen Singer relevante Textpassagen aus dieser Publikation verwendet.
Textredaktion Claus Kuge
Fotos, teilweise Hans Ulmer
Copyright:
Alle Rechte vorbehalten. Reproduktionen, Speicherungen in Datenverarbeitungsanlagen oder
Netzwerken, Wiedergabe auf elektronischen, fotomechanischen oder ähnlichen Wegen, Funk oder Vortrag
– auch auszugsweise – nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors.