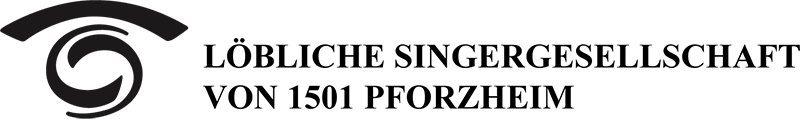Ein Kampf um Rom
Vortrag
Dr. Gerald Dörner, Pforzheim
anlässlich der Matinee zur Stadtgeschichte am 14.10.2007
„Krieg mache Platz für den Frieden, das Lob erhalte die Sprachkunst!
Was aber wenn sie die Goten nach Italien zurückrufen, um den ganzen Schatz der Literatur zu vernichten?“, so fragte der Erfurter Humanist Eobanus Hessus erschrocken in einem Schreiben den Pforzheimer Humanisten Johannes Reuchlin. Hessus dachte an den Einfall der Goten in Italien unter ihrem Heerführer Alarich I., der 410 n. Chr. zur Eroberung Roms geführt hatte. Sollte Rom wieder den barbarischen Horden aus dem Norden zum Opfer fallen. Wen Hessus in diesem Fall mit den Barbaren meinte, zeigt der weitere Brief: die Gegner Reuchlins, die zugleich die Gegner der humanistischen Studien sind.
Wie aber war nun gerade Johannes Reuchlin in einen solchen Konflikt hineingeraten, Reuchlin, ein „Stubengelehrter“, der vor allem durch seine griechischen und hebräischen Sprachstudien und durch seine beiden lateinischen Komödien Bekanntheit erlangt hatte. Der Anlaß für den Konflikt war – aus heutiger Sicht betrachtet – ein geringer: ein Gutachten, das Reuchlin im Auftrag des Kaisers erstellt hatte.
Aber erzählen wir die Geschichte von Anfang an: Im Aug. 1509 erhielt der Konvertit Johannes Pfefferkorn die Erlaubnis Kaiser Maximilians, von allen im Reich ansässigen Juden Bücher einzufordern und diese zu beschlagnahmen, wenn er in ihnen etwas für die Christen Beleidigendes oder etwas im Widerspruch zum Alten Testament Stehendes entdecken sollte. Pfefferkorn hoffte mit der Beseitigung der Bücher, vor allem des Talmud, den Juden die wichtigste Stütze ihres Glaubens wegzuschlagen und sie auf diese Weise leichter zum christlichen Glauben bekehren zu können. Bei der Darstellung des sog. „Judenbücherstreits“ erhält Johannes Pfefferkorn gern – um es im Filmgenre zu sagen – die Rolle des Schurken. Diese Sichtweise ist aber etwas einfach. Ohne Pfefferkorns Handeln beschönigen zu wollen, muß man doch auch sehen, daß er als Konvertit unter einem beständigen Rechtfertigungsdruck stand, da die Echtheit seiner Konversion angezweifelt wurde. Er war nicht mehr Jude, fand aber auch als Christ keine Anerkennung.
So beschimpften ihn Reuchlin und seine Anhänger in ihren Schriften als „Taufjuden“. Wie aber konnte man derartigen Unterstellungen besser begegnen als durch die eigenen Anstrengungen zur Bekehrung anderer.
Pfefferkorn war zusammen mit seiner Frau Anna etwa 1504/05 zum Christentum konvertiert und scheint in den folgenden Jahren als missionarischer Wanderprediger tätig gewesen zu sein, bevor er 1513 von der Stadt Köln zum Spitalmeister ernannt wurde. Das Mandat des Kaisers ermöglichte den Schritt von der Mission hin zur Aktion. Sein erstes Ziel war die jüdische Gemeinde in Frankfurt, damals die größte jüdische Gemeinschaft in Deutschland. Ende Sept. 1509 beschlagnahmte Pfefferkorn dort 168 Handschriften und Drucke und lagerte sie im städtischen Spital St. Martha ein. Er mußte die Aktion abbrechen, weil der Mainzer Erzbischof Uriel von Gemmingen protestierte. Hinter diesem Protest stand dabei weniger eine judenfreundliche Haltung des Erzbischofs, als vielmehr die Sorge um seine Rechte als Diözesan. Auch die jüdische Gemeinde wandte sich an den Kaiser. Da die Regierenden aller Zeiten knapp bei Kasse sind, war der Kaiser bereit, im Gegenzug für die Gewährung eines großzügigen Kredits durch die Juden, die Rückgabe der Bücher anzuordnen. Damit aber waren nun Pfefferkorn und seine Helfer nicht einverstanden. Auf ihren Protest hin, erklärte sich der Kaiser bereit, durch eine Kommission schriftliche Gutachten zum Talmud und zu den anderen jüdischen Schriften einholen zu lassen. Dann wolle er weiter sehen. Der Kaiser wandte also ein auch heute bei Politikern beliebtes Mittel an: Wenn man nicht entscheiden will oder nicht entscheiden kann, setzt man erst einmal eine Kommission ein. Der kaiserlichen Kommission gehörten die Universitäten Köln, Mainz, Erfurt und Heidelberg, der Inquisitor Jakob Hoogstraeten, Viktor von Karben, Konvertit und Priester, und Johannes Reuchlin an.
Die Gutachten sind zum Teil erhalten: Die Universität Köln forderte z.B. die Beschlagnahme und Prüfung des Talmud und der anderen jüdischen Bücher. Die Prüfung sollte ergeben, welche Bücher den Juden belassen und welche vernichtet werden könnten. Die in den konfiszierten Werken beanstandeten Artikel sollten gesammelt und die Juden dazu verhört werden. Verteidigten sie die Artikel und zeigten sich trotz Belehrung widerspenstig, sollten sie durch den Kaiser als Ketzer verfolgt werden. Ganz eifrig zeigte sich die Universität Mainz, die sogar die Einziehung der Bibel forderte, da sie den Juden die Fälschung des biblischen Textes unterstellte.
Das Reuchlinsche Gutachten ist das ausführlichste. Reuchlin geht darin zunächst auf die Argumente der Befürworter einer Beschlagnahme ein: 1. Die Bücher der Juden sind gegen die Christen gerichtet.
2. Sie schmähen Christus, Maria und die Kirche. 3. Sie sind falsch. 4. Sie veranlassen die Juden in ihrem Glauben zu verharren. Dagegen Reuchlin: Die Juden haben ihre Schriften aus eigenem Interesse und zum Schutz ihres Glaubens gemacht, aber niemandem zum Schaden. Zudem habe die Kirche in der Vergangenheit viele Schriften nicht verboten, die eindeutig gegen sie gerichtet gewesen seien. Mit zwei Ausnahmen habe er bei der Lektüre keine jüdischen Schriften gefunden, in denen Jesus, Maria oder die Kirche geschmäht würden. Daß die Juden Jesus nicht als göttliche Person ansähen, liege in ihrem Glauben begründet. Eine absichtliche Verfälschung der Bibel könne man ihnen nicht vorwerfen, da kein Volk mehr Achtung vor der Hl. Schrift besitze; für die Fehler seien eher die Übersetzungen verantwortlich. Die jüdischen Bücher verhinderten keine Konversion, sondern förderten diese vielmehr, wie das Beispiel des Paulus zeige.
Für den Erhalt der Bücher sprechen nach Reuchlin: Die Juden sind als Untertanen des Römischen Reiches dem Kaiserlichen Recht unterworfen; daher ist ihr Eigentum wie das anderer Bürger geschützt. Das Recht gewährt jedem bei seinem alten Herkommen und Brauch zu bleiben. Auch unterstehen die Juden nach Römischem Recht in Fragen des Glaubens und des Kultus nur den eigenen Oberen und nicht anderen Richtern. Der Vorwurf der Häresie kann bei den Juden nicht erhoben werden, da die Voraussetzung dafür nicht gegeben ist, nämlich der Abfall vom Christentum. Als Ursache für die Verwerfung der jüdischen Bücher macht Reuchlin die Unkenntnis verantwortlich, vor allem die mangelnde Kenntnis der hebräischen Sprache.
Reuchlin vertritt in seinem Gutachten keine Toleranz im modernen Sinne, keine Gleichstellung von jüdischem und christlichem Glauben. Für ihn bleibt das Ziel die Bekehrung der Juden. Dabei lehnt er aber die Ausübung von Druck (also Zwangstaufen etc.) ab. Bekehrung soll eine Sache der Überzeugung sein. Aus den jüdischen Schriften will Reuchlin dabei die Richtigkeit des christlichen Glaubens erweisen.
Vermutlich durch einen Sekretär des Mainzer Erzbischofs gelangte Pfefferkorn in den Besitz von Reuchlins Gutachten, das wie die anderen Gutachten eigentlich vertraulich war. In seiner zur Frankfurter Frühjahrsmesse 1511 veröffentlichten Schrift „Handt Spiegel“ griff er Reuchlin wütend an: Reuchlin begünstige die Juden, ja dulde selbst christenfeindliche Äußerungen. Er sprach Reuchlin die Kenntnis der hebräischen Sprache ab, packte diesen also bei seiner Gelehrtenehre: Reuchlin könne Hebräisch wie ein Esel die Treppe hinaufsteigen. Mit dem „Handt Spiegel“ brach Pfefferkorn eine literarische Auseinandersetzung vom Zaun, die als größter Flugschriftenstreit vor der Reformation gilt. Pünktlich zu den Frankfurter Frühjahrs- und Herbstmessen erschienen fortan Schriften der beiden Seiten. Dabei wurde der Ton im Laufe der Zeit immer schärfer. Zunächst war der in seiner Ehre angegriffene Reuchlin am Zuge. In seinem „Augenspiegel“ – der Titel ist natürlich eine Anspielung auf Pfefferkorns Schrift – machte er das gesamte Gutachten öffentlich, aus dem Pfefferkorn bereits verbotenerweise zitiert hatte. Zusammen mit dem Gutachten veröffentlichte er eine Zusammenstellung möglicher Gegenargumente gegen seine im Gutachten vertretenen Positionen und eine Widerlegung dieser Einwände. Im Unterschied zu den anderen Teilen des „Augenspiegel“ benutzte Reuchlin für diese „Argumenta“ die lateinische Sprache, schrieb also hier für die Fachleute. Mit den „Argumenta“ wollte Reuchlin möglichen Einwänden vorab den Wind aus den Segeln nehmen. Erst der letzte Teil enthielt die eigentliche Verteidigung gegen Pfefferkorn. Zeichnen sich die ersten Teile durch ihre Sachlichkeit aus, regieren hier Polemik und Beschimpfung Pfefferkorns, den Reuchlin auf eine Stufe mit Judas Ischariot stellt.
Mit den Mitgliedern der theologischen Fakultät der Universität Köln betreten nun neue Akteure die Bühne. Der Frankfurter Pfarrer Peter Mayer hatte Anstoß an dem in seiner Stadt verkauften „Augenspiegel“ genommen und ihn zur Begutachtung an die Kölner Fakultät gesandt. Diese prüfte die Schrift und gelangte zu der Auffassung, daß der „Augenspiegel“ ein Ärgernis für die Gläubigen darstelle. Ihm wohl gesonnene Fakultätsmitglieder legten Reuchlin eine Klarstellung der von der Fakultät beanstandeten Stellen nahe. Aber Reuchlins zur Klarstellung veröffentlichte Schrift „Ain clare verstentnus“ sorgte nicht für die nötige Klarheit. Das eigentliche Problem war die unterschiedliche Herangehensweise: Während die Kölner einzelne Stellen aus dem Gutachten und den lateinischen Erläuterungen herausgriffen, in denen sie eine Gefahr für die Gläubigen sahen, beharrte Reuchlin darauf, daß die Stellen jeweils im Gesamtzusammenhang betrachtet werden müßten.
Nachdem man sich nicht verständigen konnte, erwirkte die theologische Fakultät vom Kaiser ein Verbot des „Augenspiegel“. Das Fakultätsmitglied Arnold von Tongern veröffentlichte darüber hinaus eine Gegenschrift, in der er mehr als vierzig Stellen aus Reuchlins Gutachten aufführte, welche die Theologen missbilligt hatten. Sicherlich war die Schrift Tongerns nicht wohlwollend, die ihr vorangestellten Gedichte von Mitgliedern der Universität zum Teil ehrverletzend, ob dies aber als Rechtfertigung dafür dienen kann, was Reuchlin in seiner „Verteidigung gegen die Kölner Verleumder“ betitelten Gegenschrift vom Stapel ließ, ist fraglich. Sicherlich, Reuchlin ging in ihr auch auf die beiden gegen ihn erhobenen Hauptvorwürfe ein, die Begünstigung der Juden und die Verfälschung von Schriftstellen. Mit Bezug auf das Kanonische Recht bestritt er die Zuständigkeit der theologischen Fakultät in dieser Sache und erklärte seinen Diözesanbischof für zuständig. Dies alles hielt sich noch im üblichen Rahmen von Streitschriften. Über weite Passagen aber stellt Reuchlins „Defensio“ eine Verunglimpfung und Beschimpfung der Gegner übelster Art dar. Mein Kollege hat in einem 2003 in den „Pforzheimer Geschichtsblättern“ veröffentlichten Beitrag eine kleine Sammlung der von Reuchlin für seine Kölner Gegner verwendeten Schimpfworte zusammengestellt. Sie reichen von dem für unsere Ohren recht harmlos klingenden Bezeichnungen wie „Ränkeschmied“ (bovinator), „Trivialsophist“ (trivialis sophista) oder „Vortäuscher“ (simulator) über gröbere Schimpfworte wie „Hurenwirt“ (ganeo), „Galgenvogel“ (furcifer) und „Götzendiener“ (idolatra) bis hin zu den beliebten Anleihen aus dem Tierreich. Alle bekamen etwas ab: die Mitglieder der Fakultät insgesamt, die von Theologen zu Theologisten umbenannt werden. Viele von ihnen gehörten dem Dominikanerorden bzw. Predigerorden an, der bei Reuchlin vom Orden der „Prediger“ (praedicatores) zum Orden der „Kinderschänder“ (paedicatores) wird. Sie merken, welche Möglichkeiten die lateinische Sprache bietet. Aber auch einzelne Personen bedachte Reuchlin mit Schimpf und Spott, Arnold von Tongern, den Verfasser der Gegenschrift, Ortwin Gratius, der ein Gedicht zu Tongerns Schrift beigesteuert hatte (er wurde wegen der Bezeichnung mater Iovis – „Mutter des Zeus / Jupiter“ für Maria der Ketzerei be-schuldigt), und nicht zuletzt Johannes Pfefferkorn, für den Reuchlin wegen des Geheimnisverrats, der Bekanntmachung des Gutachtens, die Todesstrafe fordert.
Von seiten der theologischen Fakultät erwog man zunächst einen Prozeß wegen der Beleidigungen anzustrengen, nahm davon aber Abstand und ging nun stattdessen mit aller Kraft gegen den „Augenspiegel“ vor. In ihrer Sitzung vom 16. Aug. 1513 verurteilte die Fakultät den „Augenspiegel“ als „für die Ohren der Gläubigen beleidigend, als zahlreiche Artikel enthaltend, die für den Glauben suspekt und skandalös oder die sogar als häretisch zu bezeichnen sind“. Man beauftragte das Fakultätsmitglied Jakob Hoogstraeten, Prior des Kölner Dominikanerklosters, in seiner Eigenschaft als Inquisitor einen Inquisitionsprozeß gegen das Werk zu führen. Die Anklage richtete sich also gegen das Werk, nicht gegen die Person des Verfassers. Da Reuchlin vorsichtigerweise den „Augenspiegel“ dem Urteil des Papstes und der Kirche unterworfen hatte, konnte der für eine Anklage wegen Ketzerei maßgebliche Vorwurf der Verstocktheit in seinem Fall nicht geltend gemacht werden.
Als Gerichtsort wählte Hoogstraeten Mainz. Mit der Eröffnung des Mainzer Verfahrens begann ein Prozeßmarathon, der sich über sieben Jahre erstreckte. Die Mühlen der Justiz mahlten schon immer ein wenig langsam. Zunächst einmal lehnte Reuchlins Prozeßvertreter Hoogstraeten wegen Befangenheit als Richter ab, ein auch heute noch beliebtes Mittel von Anwälten: Hoogstraeten habe in der Judenbücherfrage ein eigenes Gutachten erstellt und an dem der Fakultät mitgearbeitet. Zudem könne er als Niederländer das in oberdeutscher Sprache verfaßte Gutachten nicht verstehen. In einem Zwischenurteil wies Hoogstraeten die Einwände gegen seine Person als Richter zurück und ließ auch eine Appellation nicht zu. An diesem Punkt schaltete sich nun das Mainzer Domkapitel ein, daß in Hoogstraetens Vorgehen einen Rechtsverstoß sah und eine gütliche Einigung anstrebte. Auf Bitten des Domkapitels reiste Reuchlin persönlich nach Mainz an. Hier hatte Hoogstraeten jedoch mit der Veröffentlichung eines Mandats, worin allen Gläubigen unter Androhung der Exkommunikation die Abgabe des „Augenspiegel“ befohlen wurde, bereits vollendete Tatsachen geschaffen und ein Urteil quasi vorweggenommen. Reuchlin appellierte daraufhin direkt nach der Ankunft vor einem Notar an den Hl. Stuhl.
Reuchlins Appellation wurde von der römischen Kurie angenommen. Im Nov. 1513 beauftragte Papst
Leo X. die Bischöfe von Speyer und Worms, über die Gültigkeit des Mainzer Prozesses zu verhandeln. Der Sache nahm sich jedoch nur der Speyerer Bischof Georg von der Pfalz an, ein ehemaliger Zögling Reuchlins während dessen Zeit am Heidelberger Hof, der seinem ehemaligen Erzieher wohl gesonnen gewesen sein dürfte. Im Unterschied zum Mainzer Prozeß handelte es sich hier nun nicht mehr um einen Prozeß in Glaubensfragen, sondern um ein Parteiverfahren, d.h. die beiden Parteien standen auf einer Ebene. Der Prozeß fand im bischöflichen Palast in Speyer statt. Hoogstraeten kam nicht nach Speyer, sondern schickte seinen Ordensbruder Johannes Host dorthin, dessen Vollmacht aber peinlicherweise nicht ausreichend war. Erst zum folgenden Verhandlungstag konnte Host die nötige Vollmacht vorweisen. Als das Gericht in einem Zwischenurteil aber die Berechtigung von Reuchlins Appellation anerkannte, zog sich Host schon wieder vom Prozeß zurück, indem er die Zuständigkeit des Speyerer Gerichts überhaupt anzweifelte. So konnte nun Reuchlins Prozeßvertreter ungestört agieren. Am 29. März 1514 fällte Bischof Georg das Endurteil (sententia diffinitiva): Das Mainzer Verfahren wurde für nichtig erklärt und Hoogstraeten Stillschweigen in der Sache geboten. Ausdrücklich stellte der Bischof fest, daß der „Augenspiegel“ keine von der Kirche öffentlich verurteilte Häresie enthalte, sich nicht in abschätziger Weise über die Kirche äußere und auch die Juden nicht in unangemessener Weise begünstige. Hoogstraeten wurden die Kosten des Verfahrens (111 Gulden) auferlegt.
Ein Sieg Reuchlins, aber nur ein vorläufiger; Hoogstraeten war nicht bereit das Urteil zu akzeptieren und wandte sich nun seinerseits an den Papst. Zur Unterstützung Hoogstraetens schaltete die Kölner theologische Fakultät die Schwesterfakultät in Paris ein und ersuchte sie um eine Stellungnahme zum „Augenspiegel“. Noch vor Beginn der Verhandlungen in Rom wollte man auf diese Weise durch die höchste Autorität in theologischen Fragen, die Universität Paris, ein Präjudiz schaffen. Reuchlin suchte als ehemaliger Student der Universität Paris in einem Brief die theologische Fakultät für sich zu gewinnen. Auch Reuchlins Landesherr Herzog Ulrich von Württemberg setzte sich bei ihr für seinen Rat ein. Doch vergebens – inzwischen hatte sich nämlich der französische König eingeschaltet, an den sich die Kölner Theologen über seinen Beichtvater, einen Dominikaner, gewandt hatten. In zwei Briefen, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen ließen, drängte der König die Fakultät zu einer „rigorosen Prüfung des „Augenspiegel“ “. Auch wenn es in der Fakultät durchaus Fürsprecher Reuchlins gab, konnte es angesichts des königlichen Winkes nur zu einer Verdammung des „Augenspiegel“ kommen: Das Werk enthalte – so die Universität Paris – zahlreiche falsche, unbesonnene und für fromme Ohren anstößige Sätze, auch solche, die als häretisch anzusehen seien oder die nach Häresie röchen.
Die Einflußnahme des französischen Königs zeigt, daß die Auseinandersetzungen um die jüdischen Bücher und um Reuchlins Gutachten längst kein bloßer Gelehrtenstreit mehr waren, sondern sich zu einer politischen Angelegenheit ausgeweitet hatten. Auf seiten der Kölner standen dabei neben dem französischen König vor allem Karl, der Herzog von Burgund und zukünftige Kaiser Karl V., und sein Berater Adrian von Utrecht, der zukünftige Papst Hadrian VI., übrigens der letzte deutsche Papst vor Benedikt XVI. Reuchlin hingegen genoß die Unterstützung des Kaisers und die einer Reihe deutscher Landesfürsten, darunter von Luthers Landesherren Friedrich dem Weisen. Mit der Verlegung nach Rom gewann der Prozeß eine ganz neue Dynamik. Mehr und mehr wurde er zu einem Grundsatzstreit zwischen Scholastik und Humanismus, zwischen alt und neu.
In Rom ernannte der Papst die beiden Kardinäle Domenico Grimani und Pietro Accolti zu Richtern. Die Berufung Grimanis geschah dabei auf den ausdrücklichen Wunsch Reuchlins hin. Dagegen konnte Hoogstraeten seinen Kandidaten Carvajal nicht als Richter durchsetzen. Anders als Hoogstraeten, der persönlich nach Rom zitiert worden war, durfte sich Reuchlin wegen seines Alters durch Prokuratoren vertreten zu lassen. All dies zeigt, daß man Reuchlin in Rom anfangs durchaus wohl gesonnen war.
Beide Parteien nahmen sofort Kontakt zu Personen in Rom auf, von denen sie sich Unterstützung erhoffen konnten. So wandte sich Reuchlin an den deutschen Kurialen Jakob Questenberg. Darüber hinaus suchte er eine Reihe von Kardinälen für seine Sache zu gewinnen. In den folgenden Jahren waren sie die bevorzugten Adressaten für Widmungen seiner Werke. Aber auch Hoogstraeten und die theologische Fakultät der Universität Köln hatten ihre Verbindungsleute an die Kurie. Im Sept. 1514 berichtete der Kölner Humanist Hermann von dem Busche an Reuchlin von 1500 Gulden, welche die Fakultät ihrem Mitglied Hoogstraeten bewilligt habe. Auch wenn die genannte Summe wohl übertrieben sein dürfte, so nährte die Nachricht doch Reuchlins Befürchtung, daß Hoogstraeten den Prozeß mit Hilfe des Geldes entscheiden könne.
Im Anschluß an die erste Verhandlung im Jan. 1515 kam der Prozeß an der Kurie ins Stocken, da die beiden Richter als Kardinäle durch das gerade stattfindende Laterankonzil in Anspruch genommen wurden. Hoogstraeten forderte daraufhin die Amtsenthebung der Richter. Bald wurde auch von höherer Seite Kritik am Verfahren laut. Eine neue Wendung erhielt der Prozeß durch die politischen Veränderungen des Jahres 1515. Nach der Niederlage der päpstlichen Verbündeten bei Marignano rückte das französische Heer nach Italien ein und damit dem Papst bedrohlich nah. Der Papst unterbrach daraufhin sogar das Konzil, um sich mit Franz I. zu treffen. Wohl nicht zuletzt auf Drängen des französischen Königs berief der Papst zur Beschleunigung des Verfahrens um den „Augenspiegel“ eine Kommission, wie sie bei kirchlichen Zensurverfahren üblich war. Die Kommission aber kam nach nur vier Sitzungen mehrheitlich zu dem Ergebnis, daß der „Augenspiegel“ keine häretischen oder anstößigen Stellen enthalte, und bestätigte damit das Speyerer Urteil von 1514.
Nun hätte eigentlich ein Urteil zu Reuchlins Gunsten erfolgen müssen, dazu kam es jedoch nicht, denn noch vor der abschließenden Sitzung erließ der Papst ein sogenanntes Mandatum de supersedendo (supersedere – über etwas sitzen) und verschob damit die Entscheidung auf unbestimmte Zeit. Die Methode, Probleme auszusitzen, ist also keine Erfindung Helmut Kohls. Die politische Konstellation ließ es Papst Leo geraten erscheinen, diesen Weg zu gehen, wollte er nicht dem französischen König oder umgekehrt dem Kaiser auf die Füße treten. Trotz des päpstlichen Mandates erwartete Reuchlin noch längere Zeit ein günstiges Endurteil. Im März 1517 wandte er sich im Widmungsschreiben von „De arte cabalistica“ direkt an den Papst und erinnerte ihn an seine Verdienste um die Kirche durch seine Griechisch- und Hebräischstudien.
Einige Geschehnisse aber verschoben die Konstellationen zu Reuchlins Ungunsten. Wichtige Unterstützer an der Kurie verließen Rom nach 1516. Kardinal Adriano Castellesi war in die Verschwörung seiner Kollegen Sauli und Riario gegen den Papst verwickelt und mußte nach Venedig fliehen. Und anstelle des auf den Wunsch Reuchlins berufenen Grimani wurde Domenico Giacobazzi zum Richter ernannt, weil Grimani im Streit mit dem Papst über das Ende des Konzils die Ewige Stadt verlassen hatte. Eine eher negative Wirkung dürften auch die Schriften besessen haben, die Freunde und Anhänger Reuchlins im Laufe des Prozesses veröffentlichten. Dies gilt insbesondere für die 1515 und 1517 erschienenen „Dunkelmännerbriefe“, auf die ich unten noch näher eingehen will.
Reuchlin zählte fast 60 Jahre, als der Prozeß in Rom begann. Dieser bedeutete für ihn eine nicht unerhebliche Belastung. Gegenüber seinen Briefpartnern beklagt er häufig, daß der Prozeß ihm die Zeit für sinnvolle Tätigkeiten raube. Mit zunehmender Dauer verdüsterte sich seine Stimmung, zumal das Verfahren ihm auch erhebliche finanzielle Opfer abverlangte. Immer wieder forderten ihn seine Freunde und juristischen Vertreter auf, genügend Geld nach Rom zu schicken, da sich dort nur mit Geld etwas bewegen lasse. Reuchlin fürchtete deshalb, daß seine Rücklagen für das Alter bald aufgebraucht wären. Im Nov. 1518 klagte er in einem Brief gegenüber Kardinal Pietro Accolti, daß er bereits 28 Joch von seinem Familienbesitz zur Finanzierung des Prozesses verkauft habe und sein Vermögen damit erschöpft sei. 1519 brach auch noch der Krieg zwischen Herzog Ulrich von Württemberg und dem Schwäbischen Bund aus, der Reuchlin schließlich veranlaßte, aus Stuttgart zu fliehen. Seine Lage dürfte wohl der Grund gewesen sein, daß er auf ein Angebot des Ritters Franz von Sickingens einging und diesem die Durchsetzung seiner Ansprüche aus dem Speyerer Prozeß übertrug, vor allem der Kosten von 111 Gulden. Sickingen war Unternehmer in Sachen Fehde, d.h. er lebte von den Geldern, die er durch die Drohung mit Krieg von anderen erpreßte. Im Fall Reuchlins ging Sickingen in bewährter Weise vor: Er drohte dem Provinzial und Kapitel der Dominikaner der Teutonia mit Fehde, wenn sich diese nicht umgehend mit Reuchlin einigten und die ausstehenden 111 Gulden zahlten. Angesichts der massiven Drohung sah sich der Provinzial zum Einlenken genötigt und einigte sich mit Reuchlin und Sickingen darauf, an die Kurie zu schreiben und den Papst um eine gütliche Einigung zwischen beiden Parteien zu bitten. Auch die 111 Gulden überwies er Reuchlin nach Ingolstadt. Die Ordensprovinz enthob Hoogstraeten sogar seiner Ämter, weil er ihr soviel Ärger bereitet hatte. Die Aktion Sickingens dürfte die Kurie nicht unbedingt für Reuchlin eingenommen haben, war sein Vorgehen doch eine offene Mißachtung der päpstlichen Gerichtsbarkeit.
Nicht ohne Wirkung auf den Prozeß war sicherlich auch die Reformation, gab es doch viele, die zugleich Anhänger Reuchlins und Luthers waren. In den Streitschriften wurde eine Verbindung zwischen den beiden Männern auch immer wieder betont, mochte sich Reuchlin noch so sehr dagegen wehren. Auch in dem einzigen Dokument des Vatikanischen Archivs, in dem der Name Reuchlins überhaupt erscheint, steht er neben dem Luthers. So kann die zeitliche Nähe zwischen der gegen Luther erlassenen Bannandrohungsbulle „Exsurge domine“ und dem Urteil gegen Reuchlins „Augenspiegel“ nicht wirklich überraschen: Acht Tage nach der Bulle, am 23. Juni 1520, hob Papst Leo das Speyerer Urteil auf und verbot den „Augenspiegel“ als ein für fromme Christen verletzendes und die Juden begünstigendes Buch. Er verordnete Reuchlin ewiges Stillschweigen in der Sache und brummte ihm die Kosten des Prozesses auf. Hoogstraeten setzte er wieder in alle seine Ämter ein.
Die publizistische Auseinandersetzung
Den Prozeß um den „Augenspiegel“ begleitete eine heftige publizistische Auseinandersetzung. Beide Parteien wußten ihre juristischen Siege dabei öffentlichkeitswirksam in Szene zu setzen. So ließ Reuchlin das Speyrer Urteil nur wenige Tage nach dessen Bekanntwerden drucken. Welche Bedeutung er dem Urteil zumaß, zeigt die Tatsache, daß er den vollen Wortlaut des Urteils auch im Widmungsschreiben zu seiner Übersetzung von Athanasios Schrift über die Psalmenauslegung zitiert. Der Weg von den Höhen der Psalmenauslegung bis in die Niederungen des Speyerer Urteils war dabei zwar ziemlich weit; das scheint Reuchlin aber nicht weiter gestört zu haben. Auch die Inhibition der päpstlichen Richter vom Jan. 1515, die den Kölnern verbot, in der Sache etwas gegen ihn zu unternehmen, gab Reuchlin kurze Zeit später bei Thomas Anshelm in Druck. Mit den „Acta iudiciorum“ erschien 1518 sogar ein ganzes Buch mit Dokumenten zum Prozeß um den „Augenspiegel“ bei Anshelm, als „Fortbildungsmaterial“ für Studenten des römischen und des kanonischen Rechts, wie es im Untertitel heißt.
Reuchlin stand mit seiner Vorgehensweise nicht allein, auch die Kölner Seite trieb mit Gutachten und juristischen Entscheidungen zu ihren Gunsten eifrig Öffentlichkeitsarbeit. So publizierte Ortwin Gratius mit den „Prenotamenta“ eine Sammelschrift mit der Darstellung des von Hoogstraeten geführten Mainzer Prozesses. Diese enthielt auch die Gutachten der vier theologischen Fakultäten, an die sich die Kölner Kollegen gewandt hatten, bevor sie zur Verurteilung des „Augenspiegel“ schritten. Die „Sententia condemnativa“ der Kölner selbst war natürlich auch in der Schrift enthalten. Reuchlin versuchte vergeblich beim Frankfurter Rat den Verkauf der „Prenotamenta“ auf der Messe zu unterdrücken. Noch im gleichen Jahr 1514 erschien, wie sollte es anders sein, auch das Urteil der Pariser Fakultät im Druck.
Das Pariser Urteil wurde in deutscher Übersetzung auch in der „Sturmglock“ Johannes Pfefferkorns veröffentlicht. Pfefferkorn war überhaupt, was die Veröffentlichungen in diesem Streit angeht, der produktivste. Da er kein Latein konnte, verfaßte er seine Schriften in deutscher Sprache, was ihn in den Kreisen der Humanisten allein schon diskreditierte. Nach dem „Handt Spiegel“ brachte er 1512 den „Brandtspiegel“ heraus, 1514 dann die „Sturmglock“, 1515 die „Beschyrmung“ und 1517 das „Streytpuechlin“.
Im „Brandtspiegel“ druckte Pfefferkorn u.a. das kaiserliche Mandat ab, das den Verkauf von Reuchlins „Augenspiegel“ untersagte. In dieser Schrift zitierte er auch aus den Briefen Reuchlins an die Kölner theologische Fakultät und deren Mitglied Konrad Kollin, was ein Beleg dafür ist, daß die Fakultät und Pfefferkorn in dieser Angelegenheit zusammenarbeiteten. Die „Sturmglock“ dient der Rechtfertigung der Beschlagnahme der jüdischen Bücher, die als christliches Werk propagiert wird. Pfefferkorn zweifelt darin auch die Rechtmäßigkeit des Speyerer Urteils an, da es den Gutachten der theologischen Fakultäten zum „Augenspiegel“ widerspricht und die Juden ermutigt. Das „Streytpuechlyn“ zeigt, wie sehr Pfefferkorn in die Defensive gedrängt worden war. In einer sog. protestatio wehrt er sich gegen die Bezeichnung als Jude in den „Dunkelmännerbriefen“. Er fühlt sich sogar so sehr in seiner Person angegriffen, daß er in dieser Schrift Briefe von Bürgermeistern und Räten der Städte Dachau, Nürnberg und Köln sowie des Kaisers und des Mainzer Erzbischofs abdruckt, die seine Unbescholtenheit und Ehrbarkeit bezeugen sollen. Im gleichen Atemzug greift er aber Reuchlin heftig an, den er als Werkzeug der Juden beschimpft. Die Schrift endet mit einem flammenden Appell an geistliche und weltliche Herren, dem Treiben Reuchlins und seiner Anhänger ein Ende zu setzen.
Im Unterschied zu Pfefferkorn schwieg Reuchlins eigentlicher Prozeßgegner Hoogstraeten sehr lange. Erst 1517 meldete er sich mit einer Widerlegung von 19 Artikeln des „Augenspiegel“ zu Wort. Der kleine, dem Papst gewidmete Traktat, von dem es nurmehr ein Exemplar in London gibt, erschien im Sommer 1517 in Rom, als Hoogstraeten bereits wieder nach Deutschland abgereist war. Erst als die Schrift von Juraj Dragisic erschien, sah Hoogstraeten sich zu einer ausführlicheren publizistischen Reaktion veranlaßt.
Diese Schrift des aus Kroatien stammenden Franziskaners Juraj Dragisic, der auch den Namen Georgius Benignus trug, an der Hochschule des Ordens in Rom lehrte und 1512 zum Titularerzbischof von Nazareth ernannt worden war, zeigt, daß der Streit um die jüdischen Bücher und Reuchlins „Augenspiegel“ sogar an der römischen Kurie publizistischen Nachhall fand. Die Verteidigungsschrift „Ob die Bücher der Juden, die sie als Talmud bezeichnen eher zu unterdrücken als zu bewahren und zu erhalten sind“ war als Dialog zwischen Benignus und Reuchlin angelegt. Benignus greift dabei die Positionen von Reuchlins Gegnern auf; seine kritischen Einwände und Fragen ermöglichen es Reuchlin, die eigenen Auffassungen ausführlich zu entwickeln und zu begründen.
Als Dialog war auch ein zweites aus dem Umfeld der Kurie stammendes Werk zur Verteidigung Reuchlins verfaßt. Es stammte ebenfalls von einem Franziskaner, dem Provinzial der Provinz Puglia Pietro Galatino. Gesprächspartner sind Galatino selbst, Reuchlin und Hoogstraeten, der aber kaum zu Wort kommen darf. Im Unterschied zu der eher schmalen Schrift des Benignus handelt es sich bei Galatinos Werk „Von den Geheimnissen der christlichen Wahrheit“ um ein ausgewachsenes Buch mit über 600 Seiten. Es erschien 1518 in Ortona di Mare in der Druckerei des Juden Gershom Soncino. Reuchlin sah die Schrift als eine der wichtigsten Veröffentlichungen in seinem Streit an und empfahl sie nachdrücklich zur Lektüre. Daß es gerade Franziskaner waren, die sich auf die Seite Reuchlins schlugen, liegt sicherlich auch an der Gegnerschaft dieses Ordens zu den Dominikanern begründet. Unterstützung fand Reuchlin aber auch bei den Vertretern anderer Orden in Rom. Hier sei nur wegen der Verbindung zu Luther der General des Augustinereremitenordens Egidio da Viterbo genannt, der zu den besten Kennern der hebräischen und aramäischen Sprache sowie der Kabbala in Italien gehörte. Übrigens versicherte auch Luther in einem Brief vom 14. Dez. 1518 Reuchlin seiner Unterstützung im Kampf gegen die Kölner.
Die ernsthafte sachliche Auseinandersetzung, wie sie Benignus und Galatino in ihren Schriften führten, blieb die Ausnahme. Viel lieber griff man zum Mittel der Polemik oder der Satire. Daß dabei durchaus auch Literatur von Weltgeltung entstehen konnte, zeigen die „Dunkelmännerbriefe“. Der Originaltitel der „Dunkelmännerbriefe“, „Epistolae obscurorum virorum“, nimmt den Titel einer Briefsammlung auf, die Reuchlin 1514 bei seinem Drucker Thomas Anshelm veröffentlicht hatte und die 100 Briefe überwiegend humanistischer Korrespondenzpartner an ihn enthielt. Mit diesen „Epistolae clarorum virorum“ („Briefe berühmter Männer“) wollte Reuchlin sein Ansehen demonstrieren, das er in der humanistischen Welt genoß. Mit den „Briefen unbekannter Männer“ bzw. „Briefen dunkler Männer“ bekamen die „Briefe
berühmter Männer“ ihr parodistisches Gegenstück. Die „Briefe dunkler Männer“ erschienen in zwei Teilen anonym und ohne Angabe des Druckers in den Jahren 1515 und 1517.
Die fiktiven Verfasser der Briefe tragen so wunderbar sprechende Namen wie Herbordus Mistladerius, Antonius Rubenstadius oder Bertholdus Hackstro. Adressat der Briefe ist der Professor für Poesie und Rhetorik an der Kuckana-Burse der Universität Köln Ortwin Gratius. Gratius, der eigentlich dem Humanismus zugerechnet werden darf, war durch sein Reuchlin verunglimpfendes Gedicht in Tongerns „Articuli“ und durch die von ihm herausgegebenen „Prenotamenta“ in das Schußfeld der Humanisten geraten. Schon Reuchlin hatte ihn in seiner „Defensio“ heftig angegriffen und als Ketzer beschimpft. Die „Dunkelmännerbriefe“ zogen seine Person und sein Ansehen als Gelehrter dann vollends in den Schmutz. Gratius wird als Sohn eines Pfarrers und einer Hure sowie als Neffe des Halberstadter Scharfrichters Meister Gratius diffamiert. Ihm wird ein Verhältnis zu Pfefferkorns Frau Anna sowie zur Magd des Kölner Druckers Quentel angedichtet. Als ungebildeter Trottel, der z.B. die Akzentzeichen in griechischen Texten tilgt, wird er auch als Gelehrter lächerlich gemacht.
Gratius’ Briefpartner berichten dem Meister in ihren Schreiben ihre Erlebnisse, vor allem aber ihre Kämpfe mit den Anhängern Reuchlins und des Humanismus. Dabei outen sie sich schon durch die Art ihres sich eng an die deutsche Sprache anlehnenden Küchenlateins als ungebildete Tölpel. Der „Reiter“ heißt in ihrem Latein einfach reuterus, der „Kaufmann“ kaufmannus und der „Landsmann“ eben lansmannus. Lateinische Sätze werden nach der deutschen Syntax gebildet. Die Briefe werden mit ausladenden Grußformeln eingeleitet: Salutem maximum et multas bonas noctes, sicut sunt stellae in caelo et pisces in mari – „Einen recht herzlichen Gruß und so viele Nächte wie Sterne am Himmel und Fische im Meere sind“, oder es wird gar gedichtet (in deutscher Übersetzung klingt dies so): „ Ich send Euch Gruß und Liebe, / mehr als in Polen Diebe, // In Böhmen Ketzer lauern / und in der Schweiz die Bauern, // […] Als wie in Sachsen Säufer, / und in Venedig Verkäufer // […] Als Gäule bei den Friesen / in Frankreich die Marquisen“.
Überhaupt wird im Kampf gegen die verhaßten humanistischen Poeten, zu denen man auch Reuchlin aufgrund seiner beiden Komödien rechnet, immer wieder die eigene Dichtkunst angeführt. Denn die Poeten sind keine guten Christen, weil sie allenthalben die antiken heidnischen Dichter zitieren. Außerdem erweisen die Humanisten den von den Dunkelmännern verehrten Theologen, den magistri nostri, nicht die nötige Reverenz, sondern machen sich sogar über diese lustig.
Zu ihrem großen Ärger treffen die Dunkelmänner aber überall auf die Anhänger Reuchlins. In einem rhythmischen Gedicht berichtet ein Magister Philippus Schlauraff von seiner Reise durch Deutschland, bei der er allenthalben von Reuchlinisten Prügel bezieht oder beschimpft wird. Unter anderem führt ihn sein Weg auch ins Schwabenland (in Übersetzung): „Um Stuttgart ging ich ganz herum/ dort hat sein
Domicilium // dieser Ketzer Reuchlin, / der mir ganz verdächtig schien. // Nach Tübingen dann ging ich
fort; / viele Burschen sitzen dort // Die neue Bücher machen / und die Theologen verachten. // Deren übelster Patron ist Philippus Melanchthon; // Was ich selbst erprobte, / daher ich Gott gelobte, // Sollt ich den als Leichnam sehn, / so wollt ich zu St. Jakob gehn.“ Ein früher Hape Kerkeling: „Ich bin dann mal eben weg“.
Gern führen die Dunkelmänner ihre scholastische Argumentationskunst ins Feld, gerade auch bei so dankbaren Themen wie der sexuellen Freizügigkeit des Klerus. Magister Konrad von Zwickau an Gratius: „Es ist gar erfreulich die Weiber zu lieben, nach dem Spruch des Dichters Samuel: ‚Lerne guter Kleriker, hübsche Mädchen lieben, // Denn sie können womöglich dich im Küssen üben’. Denn Liebe ist Nächstenliebe; und da Gott die Nächstenliebe ist, kann die Liebe [auch für Kleriker] nichts Böses sein.“
Ein beliebtes Ziel der Satire sind die Dominikaner. Ein immer wiederkehrendes Thema – nicht nur in den „Dunkelmännerbriefen“ – ist der Sündenfall des Ordens im sogenannten „Jet-zerhandel“, als Mönche des Berner Dominikanerklosters mehrfach Maria erscheinen lassen, die bei ihren Auftritten bekennt, in Sünden (von ihrer Mutter Anna) empfangen worden zu sein. Mit diesen Erscheinungen wollten die Dominikaner ihre Haltung im Streit um die Lehre von der „Unbefleckten Empfängnis Mariens“ stärken, die sie ablehnten. Leider flogen die gelungenen Inszenierungen irgendwann auf und die Mönche landeten in Bern auf dem Scheiterhaufen.
Auf Drängen der Kölner Fakultät wurden die „Dunkelmännerbriefe“ noch 1517 durch Papst Leo X. verboten, Autoren und Drucker des Werkes mit der Exkommunikation bedroht. Trotz aller Kritik, die in den „Dunkelmännerbriefen“ und in den anderen Schriften der Reuchlinisten auch am Zustand der Kirche, am Papsttum und an der römischen Kurie sowie am Klerus geübt wird, eine grundsätzliche Infragestellung enthalten sie nicht. Dies war die Sache der Reformation. Im Vergleich zur Schlacht mit der Druckerpresse, die um der Reformation willen geführt wurde, war die publizistische Auseinandersetzung um die jüdischen Bücher und um Reuchlins „Augenspiegel“ ein kleines unbedeutendes Vorgeplänkel. Reuchlin selbst
beteiligt sich nach 1518 kaum mehr an der publizistischen Auseinandersetzung; er sehnte sich nach einem Ende des Streits und nach Ruhe für seine Studien. Mit der Sache Luthers mochte er nicht in Verbindung gebracht werden. Von Ulrich von Hutten mußte er sich Feigheit vorhalten lassen: Du schreibst, Du habest die Sache Luthers immer missbilligt, es für unerträglich gehalten, daß Dein Name in seinen Schriften erscheine. […] Unsterbliche Götter, was sehe ich? Daß Du aus Furcht und Schwäche Dich soweit erniedrigst. […] Mit so schimpflicher Schmeichelei hoffst Du, die zu besänftigen, die Du, wenn Du ein Mann wärest, nicht einmal freundlich anreden dürftest. Aber besänftige sie nur […], gehe, wenn es Dein Alter erlaubt, nach Rom und küsse Papst Leo die Füße. Über Reuchlin schien die Zeit hinweg gegangen zu sein. Als er im Juni 1522 starb und an der Seite seiner zweiten Frau in Stuttgart begraben wurde, fand der Tod des einst so gefeierten und bejubelten Mannes und Gelehrten kaum mehr Beachtung.
Copyright:
Alle Rechte vorbehalten. Reproduktionen, Speicherungen in Datenverarbeitungsanlagen oder Netzwerken, Wiedergabe auf elektronischen, fotomechanischen oder ähnlichen Wegen, Funk oder Vortrag – auch auszugsweise – nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors.